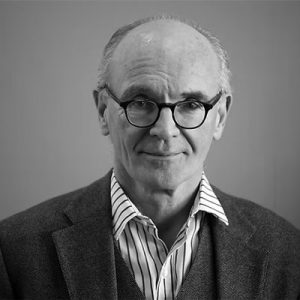12.04.2025 – News – Berliner Zeitung – Judith von Sternburg — – Details
Martin Mosebach
Martin Mosebachs lässiger Künstler-Roman ist unterhaltsam, aber auch sehr böse. Die Figuren bekommen davon wenig mit. Die Leser genießen die gefeilten Ideen. Die Kritik — Der Schriftsteller Martin Mosebach wurde 2007 mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet.
Hier kommt ein böses Buch über einen Künstler, aber es fängt harmlos an, fast ein wenig banal. Eine Vernissage der renommierten Galerie Grünhaus steht an, der berühmte Maler Louis Creutz schaut vorher im Atelier, dass er schon einmal etwas Neues probiert. Dieses Gefühl braucht er vor einer Ausstellung, dass es weitergeht mit etwas, das noch keiner gesehen hat. «Dass er solcher Vergewisserung bedurfte, mochte Leute, die ihn kannten, überraschen. So wie er auftrat, galt er als Inbegriff der Unbeeindruckbarkeit, unerschütterlich bis zur Gleichgültigkeit.» — Auf der Vernissage selbst das übliche Getümmel, der Juniorchef schon mit aufgelösten Konturen durch die vielen Begrüßungen, denn Martin Mosebach hat das geschrieben – und an glänzenden Beobachtungen ist kein Mangel. Gute Bekannte sind gekommen, Menschen, die mit dem Künstler geradezu befreundet sind. Und jetzt kommt auch schon die Titelheldin ins Bild. Das sei «die Richtige», sagt Beate, und sie meint das nicht freundlich, spricht im Gegenteil kurz darauf von der «nordischen Kuh». Astrid ist ihr Name, aus Schweden. — Die Richtige ist sie, weil es gut sein könnte, dass Louis Creutz sie malen will. So kommt es dann auch. Von Louis Creutz gemalt zu werden, erweist sich im Verlauf der Handlung als gefährlich, wobei der Maler gar nicht so viel dazu beizutragen scheint. Wenig beizutragen, kann aber fatal sein.
Mosebach›sche Motive sind nie platt, nie zu direkt Der neue Roman von Mosebach ist nicht sein erster über einen Künstler und nicht sein erster über einen Menschen, den man einen Gewalttäter nennen will, obwohl er nichts weiter tut, wie gesagt. Aber so unerfreulich wird es selten. So kalt. So zweifelt auch ein Künstler selten an einem anderen Künstler, wobei der eine eben Schriftsteller, der andere Maler ist. Creutz, der viele Dinge denkt, die man nicht erwartet, stellt sich vor, dass er, wenn er erblindete, Schriftsteller würde. Wenn er aber schreibt, disparate, erratisch an Menschen seines Umfelds geschickte elektronische Notizen, fühlt er sich wie ein Vogel, «der die Flügel ausbreitet, aber nicht fliegt». — Vögel sind ein Motiv im Roman, freie und unfreie, unabhängige und abhängige Vögel, fragile Tiere, denen nur nichts Schlimmes geschieht, wenn sie schnell genug entweichen können. Vor Louis Creutz, obwohl er kein Mörder und nicht einmal ein offizieller Missetäter ist, muss man sich vor allem in Acht nehmen. Aber Mosebach›sche Motive sind nie platt, nie zu direkt, wohingegen Creutz selbst durchaus platt und direkt sein kann. Eine dümpelnde Azalee in seinem Atelier blüht noch einmal, bald darauf wirft er sie doch auf den Müll, weil sie sich offenbar verausgabt hat. «Ich habe keinen Sinn für Leute, die nicht durchhalten», sagt Creutz. Dass es um eine Zimmerpflanze geht, ist nicht von Belang. Menschen behandelt er nicht respektvoller als Gegenstände. Über Astrid heißt es bald: «Sie ist gut geparkt und läuft nicht weg.» — Jagd ist ein anderes, noch wichtigeres Motiv. Nicht nur ist der Maler auf der Pirsch, nicht nur ist «die Richtige» aus seiner Sicht eine Beute, sondern Beates Schwager Dietrich ist auch ein passionierter Jäger. In einer großartigen Szene begleitet Creutz ihn auf eine Jagdpartie. Er friert sich die Füße ab, würde das aber nie zugeben – «zu seinen Prinzipien gehörte es, Spezialausrüstungen zu verachten» –, den stillen Dietrich, einen unauffälligen Mann und ernstlich erfolgreichen Unternehmer, erlebt er hier als kompetenten Jäger. Louis Creutz hätte «in der bürgerlichen Gefahrlosigkeit seiner Existenz» nichts dagegen gehabt, wenn sich für ihn eine gewisse Gefährdung ergeben hätte, bevor Dietrich den Eber erschießt. Dietrich aber winkt ab, keine Gefahr. (…) —
SK-news